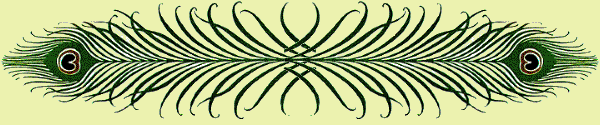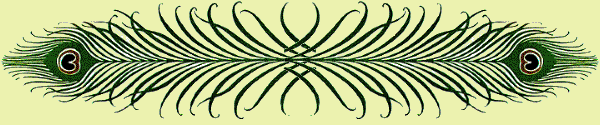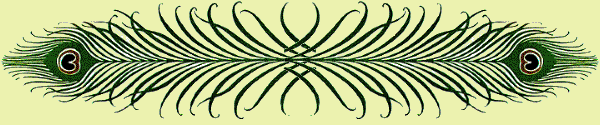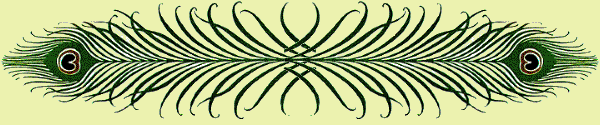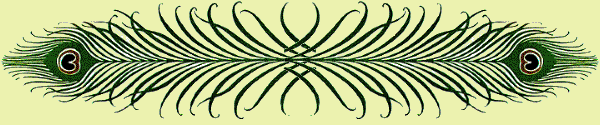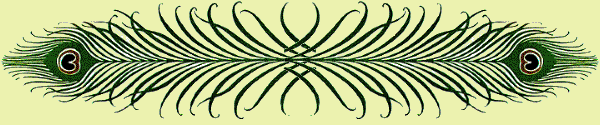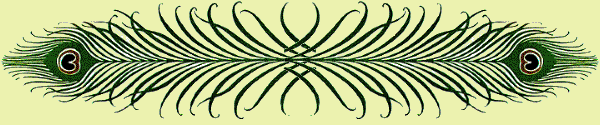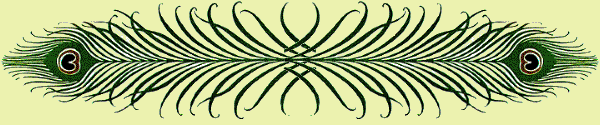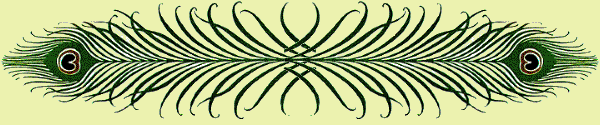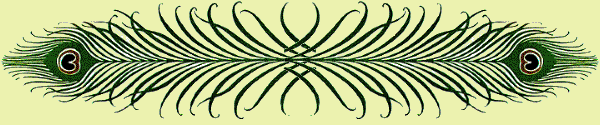Geschichten
Eine sonderbare Krippe
Immer
wenn es auf Weihnachten zu ging, sahen wir Kinder wunderschöne Krippen.
Teils in den Auslagen der Geschäfte, in der Kirche, aber natürlich
hatte auch jeder so eine heilige Familie zu Hause. Am Heiligen Abend
stand sie im Weihnachtszimmer, indirekt beleuchtet, wo das Jesuskind mit
Mutter Maria und Vater Josef auf die Hirten mit ihren Schafen warteten.
Je näher der Heilige Abend kam, erwachte in uns der Wunsch, auch so
eine Krippe zu besitzen. Eines Tages, wir Kinder Saßen
mal wieder auf unserem Heuboden, da kam uns die Idee, selbst eine
Krippe zu basteln. He, wäre ein gutes Material dafür, ich kannte schon
ähnliches. Als ich kleiner war, machte mir meine Großmutter einmal eine
Puppe. Sie kaufte einen Puppenkopf aus Blech, nähte einen durchgehenden
Anzug, und stopfte diesen mit feinem Heu aus. Dann häkelte sie zwei
kleine Handschuhe, zwei kleine Schuhe und nähte sie an den Anzug,
brachte noch den Kopf an, ein rotes Schleifchen um den Hals und fertig
war meine Puppe Heini. Leider hatte Heini kein langes Leben, Mäuse
nahmen ihn in Besitz als Nestmaterial für ihre Kinderstube. Dazu muss
man wissen, dass sich all dieses nach dem 2. Weltkrieg zugetragen hat.
Nun besprachen wir, wie wir die Krippe machen wollten und wie sie
aussehen sollte. Jeder besorgte etwas, Zwirn, ein paar übriggebliebene
Stoffreste, von neu genähten Schürzen, den Teil eines alten Hemdes,
außerdem ein bisschen Schleifenband von meinen Zöpfen. Aus feinem Heu,
fertigten wir zwei größere und eine kleine Figur. Jede wurde mit Stoff
beklebt. Maria mit Umhang und Kopftuch, auch Josef bekam einen Umhang
und das Jesuskind eine bunte Blümchenwindel aus dem Schürzenstoff aus
dem auch Marias Kopftuch war. Jetzt hatten wir also eine Heilige Familie
beisammen, aber leider fehlte uns noch die Krippe und niemand wußte so
recht, wo die wohl herkommen sollte. Da fiel mir auf einmal unser
kleiner, leerer Kaninchenstall ein, der könnte doch eine wunderschöne
Behausung abgeben. Gesagt getan, er wurde mit Moos und Tannengrün
ausgelegt, welches wir aus dem nahen Wald geholt hatten. Auch
ein paar Ilex Zweige mit roten Beeren, steckten wir links und rechts in
die Bretter. Dann setzten wir Maria und Josef hinein und legten das
Jesuskind in die Raufe. Überall wurde noch ein bisschen gezupft und
gerichtet, dann war uns klar, diese Krippe war die Schönste auf der
Welt, denn wir hatten sie gemacht. Abends wurde die Tür mit dem
Drahtgitter geschlossen, am Tage jedoch, konnte sich jeder von ihrer
Schönheit überzeugen.
I. Reimann
Das ist die
Geschichte einer kleinen Seifenblase, die auch einmal einen Weihnachtsmarkt sehen
wollte
Mitten in
der Stadt, nicht weit vom Rathaus, stand das große Kaufhaus. Bald kommt
der heilige Abend und da wollte ein jeder noch schnell ein paar hübsche
Sachen einkaufen. Die Schaufenster waren wunderschön dekoriert, in einem fuhr
eine Eisenbahn immerzu ihre Runden durch den Weihnachtswald, die Tiere an
denen sie vorüberkam, nickten mit dem Kopf und drehten sich hin und her, als wollten
sie sagen, damit möchten wir auch einmal fahren, daß müßte herrlich sein und
der Weihnachtsmann der dabei stand, schwenkte seinen großen Sack, als würde er
ihn gleich in einen Wagen bevördern, damit die Kinder schneller zu ihren
Geschenken kämen und er nicht mehr soviel zu tragen hätte. Gerade über diesem
Schaufenster,saß ein dicker kuschelieger Teddybär. In der einen
Pfote hielt er eine kleine goldene Dose und mit der Anderen tauchte er ein
Stöckchen hinein,daß am Ende eine kleine Schlinge hatte.Dieses hob er an seinen
Mund und blies mit seinen dicken Pausbacken, daß die Seifenblasen nur so
herauskugelten und bis weit in die Stadt hinein flogen. Eine kunterbunt
schimmernde Seifenblase, hatte der Wind auf die Einkauftasche einer alten Dame
getragen, dort ritt sie jetzt stolz, wie auf einem schwarzen Pferd. Eine ganze
Weile, träumte sie so vor sich hin, schaute mal ein bischen nach links und
manchmal auch ein bißchen nach rechts, wenn einige ihrer Schwestern und
Brüdern vorüberflogen.Auf einmal spitzte sie ihre Ohren, da hatte sie doch
gerade gehört, wie die alte Dame zu ihrem Mann sagte, daß sie noch gerne auf
den Weihnachtsmarkt gehen möchte, der doch so schön wäre , mit all seinen
bunten Häuschen Lichtern, den leckeren Lebkuchen und dem schönen Spielzeug. Und
dann könnten sie ja auch gleich noch ein paar hübsche Geschenke, für ihre
Enkelkinder suchen. Die kleine kunterbunte Seifenblase, war sehr neugierig
geworden, den Weihnachtsmarkt, wollte sie jetzt aber auch sehen,die alte Dame
ging ihr garnicht schnell genug.Plötzlich hörte sie leise Weihnachtsmusik, die
mit jedem Schritt lauter wurde. Dann roch es
auf einmal so gut und es wurde hell und immer heller, daß muß der Weihnachts
markt sein jubelte sie und hopste vor Freude so hoch, daß der Wind sie mitnahm
und hui gings hoch über die Köpfe der vielen Menschen hinweg, mitten hinein in
den Trubel. Da sah sie
all die schönen Dinge, von denen die alte Dame gesprochen hatte und es war noch
viel schöner und herrlicher, als sie es
sich erträumt hatte.Der Wind nahm sie mit, von Häuschen zu Häuschen, über den
ganzen Platz bis hin zu einem Kinderkarussel.Da muß ich auch einmal mitfahren,
lachte die kleine Seifenblase und setzte sich auf eine knallrote Feuerwehr. Als die
Fahrt zu ende war, stiegen neue Kinder ein. Eines entdeckte die
Seifenblase," oh seht mal,
eine Seifenblase rief es," griff danach und
pitsch war sie zerplatzt I. Reimann
A rechtiger Hoahn
Ei daan Zeita, wu doas Faderviech off’m Pauerhofe nooch frei
remmlaafa kunde woar emmer orndliech woas lus oam Freigelände. Wie amoal a
Hoahn met seiner Hinnerschoar nohnde o am Teiche nooch Wärmarn schorrte, koam a
ääne Entaschoar oagewaatschelt: „ Gaak! Gaak! Gaak!“ machta se, on platzschta
asu sachte daam Teiche zu. Doo ruhrte siech doch doas Verantwortongsgefiehl vu
daam Hoanne! - Schließliech woar a ju verantwortliech fer doas Faderviech! „Watter, watter dooblein! Watter, watter dooblein!“ gockert
ar. Oaber die Enta waatschelta ohne oazohaala daam Teichrande zu. „ Watter
dooblein!“ kund ar groade nooch sään, oaber doo woarn se schonn doas Rändla
nonder ei daan Teich gerutscht. Die Enta frääta siech! „ Gaaak! Gaaak! Gaaak!“
machta se, schluga met a Fliegan on tauchta ock ihre Käpplan emmer ei doas Woasser
nei. Der Hoahn doochte die wärn woll sähr ei Bedrullie on schempfte miet a: „
Iech hoa’s Oich ju gesäät! Iech hoa’s Oich ju gesäät! Iech hoa’s Oich ju
gesäät!“ krääscht a. Die Enta schittelt siech vu Frääda on verfuhrta a
rechtiecha Tänzla off daam Woasser. Der Hoahn stoand nee weit vum Teichrande,
kund oaber doch nee halfa on krehte bloß: „ Warom gitter datt hie! Warom gitter
datt hie! Warom gitter datt hie! Tomme
bräätfissieche Verwandschaoft! Gooack! Gooack! Gooack!“ gockerta, schoarrte met
a Fissa on hoatte derbei a Wärmla fer seine Puttlan freigeschoarrt. Seine Puttlan
koama, beguckta siech daan Fund, woßta nee wam da gehäärn kende, on doo froaß
ar’s halt salber. Der Hoahn schoarrte wetter on knorrte siech ärgerliech ei sänn Boart: „ Ma hoot doch hoite gooar nischt nemme zo
sään! Gooar nischt hoot ma nemme zo sään!
Gooar nischt! Gooar nischt! Gooar nischt!“
Erhard Gertler
Wondratzeck
Sicherlich nicht richtig geschrieben, im Oberschlesischen
mit anderen Schriftzeichen versehen, aber, wir sprachen den Namen so aus.
Herr Wondratzeck war kurze Zeit Gast in unserem Haus, in Gabersdorf. Pensionsgast, Teilpension, Übernachtung mit Frühstück. Er
arbeitete im Straßenbau, an der neuen Staße zwischen Wiltsch, Herzogswalde und
Silberberg. Also im Höhenstraßenausbau. Welche Tätigkeit er ausübte weiß ich
nicht mehr. Ich weiß nur, daß vom Mittelpunkt in Wiltsch, schräg den Berg hoch
die neue Straße gebaut wurde. Viele Arbeiter und eine Dampfwalze sah ich da. Herr Wondratzeck war ein lieber Gast, freundlich,
bescheiden, liebevoll. Meine Mutter war immer beeindruckt wie leise er, die
eigentlich knarrende Treppe herunter kam, um sich am Waschständer zu waschen,
und dann am Frühstückstisch erschien. Nicht lange muß diese Zeit gewesen sein,
doch mindestens zwei Jahre hinter einander bekamen wir eine Weihnachtsgans aus
Oberschlesien.
Die Straße ist noch heute ein wunderschöner Höhenweg, aus
der Grafschaft hinaus, mit einem herrlichen Blick auf die Festung Silberberg,
Richtung Herzogswalde, Schönwalde, in das flache Land, wie wir zu sagen
pflegten.

Erhard Gertler
Die verkoarschelte Goarkasoaloate
Maxe woar nooch a
jonges Perschla, lediech, fiedel on noigierich off oalls woas oageboota wurde. Es woar die Zeit, die mer
hoite „a Aufschwung“ nenna. Gedoarbt hoatt ar genunke, ver der Währongsreform. Etza goabs woas zo assa, zo sahn, on zo derlaaba.
Reisen woar Mode! Eesterreich hoatte die Graanza uufgemacht, on oalls sterzte
hie! Maxe wullde natierliech a datt sein! Salzburg hoatte ar siech ausgesucht!
Och, wie offte hoatte ar gesonga: „ Was kann der Siegesmund dafür das er so
schön ist?... “ On doo derbeine doochta oa siech! – Viel lieber nooch soang ar:
„ Salzburger Nockerln! Salzburger Nockerln! Süß wie die Liebe und süß wie ein
Kuß!....“ Nockerln doocht ar, doaß sein ääne Oart Kließlan, vleicht Pflauma-,
Kärschakließlan, oder asu woas ähnlieches, jedenfoalls, sisse. Denn assa toat
ar ganne, nee blooß Kließlan, a Gemiese, wie zom Beispiel „Goarkasolaote“. Wie
doas halt asu ies, ääne Rääse macht doarschtiech on a hongriech! Maxe woar
Salzburg oalle soat, ar hoatte Honger! Spaorsoam wie ar woar, suchte ar nooch
ämm Goasthause woas nee asu eim Mettelponkte loach. Datt woarsch belljer, doas
woaßt ar. Ar foand ääs, sogoar nobel!!!
Met Kellner eim Frack, on eim Aushange woarsch gaor nee asu toier! Also nischt
wie nei! Wie ar doo asu allääne oam Tesche soaß, soach ar asu änn decka Moan
met seiner Frau oam Nabatesche. A Amerikaner, wie dar salber sääte: „ We Ämmärrikäns!!“ hooart a blooßiech. Dar oaber oaß Schnitzel,
Bunn, on „G o a r k a soaloate!!“ Kääne
Soalzburger Nockerl . Es woar vleicht Juni, es goab die Goarka nooch nee asu
wie hoite doas ganze Joahr! Die Goarkasoaloate stiech Maxan ei die Noase, on
doas Woasser lief em ein Maule zosoamma. Ei daam Momente koam der Kellner eim
Frack: „Sie wünschen der Herr!“ Maxe woar ganz verdattert, Wonsch on
Wärkliechkäät koama doarcheinander on ar sääte: „ Salzburger Nockerln, mit
Gurkensalat!!“ Der Kellner soach Maxan
ganz mettläädiech oa, on sääte heefliech: „ Schaun’s gnädger Herr, Soalzburger
Nockerln und Gurkensoaloat, des paoßt net! Soalzburger Nockerln, des iss a
Süßspeiß! Nehms die Nockerln un vielleicht danach a Melange*, des is besser,
gnädger Herr!“ Maxe soach verschaamt oa siech nonder, doochte, nä, doo sein woll met dir die Pfarde doarchgeanga, on neckte blooß.
Jedesmaol, wenn ar Melodien aus der Operette „ Saison in
Salzburg,“ häärt denkt ar os die verkoarschelte Goarkasoatloate.
*Kaffee-Milchgetränk
Erhard Gertler
Das Osterei
Martha, die Magd auf dem Lindenhof, stand am Ostermorgen vor
dem kleinen Spiegel in ihrer Kammer und flocht ihre Haare. Nur mit Mühe konnte
sie die blonde Fülle in zwei langen Zöpfen bändigen. Durch das Fenster sah sie,
wie Olga, die Tochter ihrer Bauersleute, im Blumengarten suchte. In der
Buchsbaumhecke fand sie ein volles Osternest und beim Rosenbusch ein zweites.
Sie suchte aber immer noch weiter und ging auch in den Laubengarten hinüber,
ohne aber etwas zu finden, wiewohl sie dort jede Ecke durchstöberte. Ehe Martha
zum Gesangbuch griff, um zum Festgottesdienst zu gehen, eilte sie rasch in das
Brunnengärtlein, um sich einen Strauß Osterblumen für ihr Kämmerlein zu
pflücken. Da sah sie in der Fliederhecke ein Nest aus weichem Heu. Darin lag
ein rotes Osterei mit einem blauen Bande. „Das gilt doch mir!" schoß es
Martha durch den Kopf und eine Glutwelle flutete ihr über die Wangen. Also
hatte sie vorgestern beim Krämer doch recht gehört. Da war der jüngste Sohn des
Nachbarbauern, der Oswald, gerade beim Bezahlen gewesen als sie den Laden
betrat. „Das rote Osterei," hatte sie ihn noch sagen hören,„das mit der
blauen Schleife, ist für Hermann, unseren Großknecht und das goldene für meinen
Bruder Wilhelm." „Schau einer den Hermann an!" ging es Martha durch
den Sinn. „Getraut sich kaum ein Wörtlein mit mir zu reden an eine Zärtlichkeit
gar nicht zu denken, aber ein Osterei legt er mir ins Nest. Ei! Ei!"
Leichtfüßig eilte die Magd mit ihrem Fund in ihre Kammer. Mit gespannter
Neugier löste sie die blaue Schleife. Als sie die Hälften des Eies
auseinanderklappte, blitzte ihr ein zierliches Ringlein mit einem funkelnden
Steine entgegen. „Ach wie schön! Ach wie schön!" jubelte das Mädchen
entzückt und klatschte die Hände ineinander. „Schau einer den Hermann an! So
ein lieber kleiner Duckmäuser! Schenkt mir solch einen feinen Ring! Und wie er
paßt! Wie angegossen!" Martha konnte es heute gar nicht erwarten,
daß der Tag zur Neige ging. Kaum hatte sie den letzten Handgriff der
Abendarbeit verrichtet, da eilte sie in ihr Kämmerchen, legte nochmals ihren
Feiertagsstaat an, nestelte ihre Haare zurecht, schob den Ring an den Finger
und schlich heimlich zur Schlehdornhecke, die vom Nachbarhofe zum Oberdorf
führte. Sie wußte, das Hermann immer an dieser Hecke lang seinen Weg nahm, wenn
er nach Feierabend sein Mütterchen besuchen ging. Das Mädchen hatte kaum die
Dornenbüsche erreicht, da sah es Hermann aus dem Nachbarhof treten. Martha
hielt ihm die Hand mit dem blitzenden Ring dicht vor die Augen und jubelte,
„Schön ist er! Schön! und schon schlang es die Arme um
seinen Hals. Hermann, der überhaupt nicht wußte, wie ihm geschah, war ebenso
verlegen wie überrascht. Wie sollte er ahnen, daß Martha am Morgen in einem
Nest ein Ei mit einem goldenen Ring gefunden hatte und nun glaubte, er habe ihr
diese Ostergabe beschert. Aber trotz aller Verwunderung dachte er jetzt
natürlich nicht daran, sich das junge blühende Mädel vom Halse zu schütteln.
Das brachte selbst ein so scheuer und zurückhaltender Mann wie er einer war nicht
fertig. Im Gegenteil! Zaghaft zwar zunächst, aber dafür dann umso fester hielt
er das Glück, das ihm so unvermutet in die Arme geflogen war, umfangen und gab
es auch so leicht nicht wieder frei. Von der entgegengesetzten Seite schritt
dieselbe Schlehenhecke entlang ein anderes Pärchen: Wilhelm und Olga, die
beiden benachbarten Bauernkinder. Mit List und Schläue kam die Tochter des
Lindenhofes bald dahinter, daß der junge Nachbar ihr ein Osterei mit einem
Ringlein während der letzten Nacht in die Fliederhecke des Brunnengärtleins
geschmuggelt hatte. Sie hatte am Nachmittag dann auch noch das Nest gefunden
aber leer. Olga stieß nun plötzlich ihren Begleiter an und flüsterte:
„Da! Schau! Unser Marthel mit eurem Hermann." „Die sind schon weiter als
wir zwei," lachte Wilhelm zurück. „Ihr zwei feiert wohl hier stille
Verlobung?" „Das kann wohl sein," gab Martha schlagfertig zurück.
„Und schaut: der Verlobungsring ist auch schon da." Dabei hielt sie die
Hand mit dem Goldreif in das Mondenlicht. Olga erhielt durch unaufällige
Zeichen von ihrem Partner die Bestätigung; „Das ist der Ring!" Nachdem
noch eine lange Weile ein heiteres Worlgeplänkel hinund hergeflogen war, wurde
Wilhelm plötzlich ernst und sagte: „Hermann, ich glaube, daß es nun Zeit wird,
daß Du Dich nach einer eigenen Scholle umschaust. Wenn ich recht gehört habe,
sucht der alte Hielscher einen zuverlässigen Käufer für seinen Hof."
„Aber, Wilhelm, wo nehme ich das Geld her?" „Ja, glaubst Du denn, daß mein
Vater seinen tüchtigen Hermann im Stich lassen wird?" Und Olga pflichtete
sofort bei: „Auch der Lindenhof wird seiner braven Martha helfen so weit es
möglich ist." Übermütig fuhr sie dann fort: „Martha, aber eine
Entschädigung verlange ich für..." Beinahe hätte sie sich wegen des Ringes
verplappert. Und Martha fragte auch schon verwundert zurück: „Entschädigung?
Wofür? Doch Olga faßte sich nach kurzer Verlegenheil schnell und lachte:
„Weil..., ja, weil du mir mit der Verlobung zuvorgekommen bist! Und dafür
verlange ich als Entschädigung..., aber das brauchen die garstigen Männer nicht
zu hören..." Sie nahm Martha einige Schritte beiseite und flüsterte ihr in
die Ohren: „Dafür verlange ich als Entschädigung Euren ersten Patenbrief."
Da nun Hermann tatsächlich kurze Zeit später den Hielscherhof übernahm
und eine tüchtigere und umsichtigere Bäuerin nie hätte finden können, führte er
wenig Monate nur später Martha glückstrahlend zum Traualtar. Am Hochzeitstage
plauderte Oswald endlich aus, daß er die beiden Ostereier, die er für Hermann
und seinen Bruder gekauft hatte, auf dem Heimwege verwechselt hatte. Erst jetzt
erfuhr Martha, das Hermann mit dem Osterei seiner Mutter eine Freude bereitet
hatte und für wen der Ring, den sie in der Fliederhecke gefunden hatte, in
Wahrheit bestimmt gewesen war. „Trag diesen Reif,“ sprach Olga zu der Braut,
der diese Offenbarung große Verlegenheit bereitete, „Als Symbol dafür, daß wir
vier, Dein Hermann, Du, mein Wilhelm und ich, immer und ewig gute Freundschaft
halten wollen!“
Alfred
Tost
Doas Nekelsscheffla
Erich Linde-nach Paul Keller
Oalle Joahre koam der Nekels zu Ignatzan, daam Siehnla vom
reicha Meller. Zo mir oaber koam ar ieberhaupt ne. Oam Tage nooch'm Nekels-Omde
zeichte mer Ignatz dann emmer doas schiene Zeug, woas em der guude Moan gebroacht
hoatte. Weil, oan meine kluuche Tante mer amool gesäät hoatte, doaß de der Nekels ons
verlächte iebersahn tät, weil mer eiem klänn aala Häusla laba, ließ iech mer doas vom Nekels a ganz
poar Joahre gefoalla. Etz woar iech oaber zahn Jahre aalt oan hoatt'
mer viergenumma, daam Nekels a Stekke ei de Kehne zo giehn oan eh'ar ei Mellersch Haus geng, uuf onser Häusla zo zeija. Wie Ignatz sääte, kääm dar guuda Moan emma ooms hoalb achte. Der 6. Dezember woar gekomma, oan iech woar emma hoalb
achte draußa. „Herr Nikolaus", wullt iech sään, „Herr Nikolaus,
bitte schön, ich wohne dort drüben in dem kleinen Hause hinter den Kastanienbäumen. Wenn Sie etwas näher gehen, werden Sie das Haus schon sehen! Ich kann
den Katechismus besser als der Müller-Ignatz, und bei der Schulprüfung habe ich sogar eine Belobigung
gekriegt und der nicht!" Asu wullde iech oall's sään. Lange hoa iech mer doas oall's
ieberleet oan kunnde meine Rede ganz auswendich. - Oaber 's woar halt aäne vo
daan schinn Reda, die de ne gehaala warn! Denn wie der Nekels koam a gruußer
Moan met em langa, welda Boarte, met em zottlicha Pelzmantel oan met em Struuhsääle oan ääner
Keete drieber em a Bauch, do rutscht' mer's Hazze ei de Hosa. Hender daam Zaune,
wu iech miech erscht amool verstackt hoatte, wär' iech ver Angst baale
gestoarba, wie ar verbeigeng. Erscht, wie ar weit genuck fatt woar, kriecht' iech meine
Courage wieder oan plääkte henderhar: „Herr Niklas, Herr Niklas, ich wohne
dort, dort drüben ei daam klänn Häusla hender daam Kastanienbame! Der Nekels drehte siech ne amool em oan geng ei de Miehle
nei, zo Ignatzan. Iech zetterte oam ganza Leibe, oan's trieb mersch 's Woasser
ei de Aacha. Heuer war iech halt wieder amool nischt krieja. Weil, oan der
Nekels hoatte ääne decke Metze ieber de Oahr'n gezaän, ward ar wull nischt vo
meinem Anoochplääka gehärt hoan. Doas rnet'm Katechismus oan dar Belobigung
hoatt iech wääger daam Schrecke asugoar vergassa. Wie iech daan Omd eim Bette loach, kunnt iech erscht ne eischlofa.
Iech doocht mer, doaß iech ei memm ganza Laaba ne wieder war fruh sein kenna. Eim Traame oaber kriecht iech vom Nekels zwee Bleisoldoata
geschankt, enn ruta oan enn blooa. A andan Tag hoatte Ignatz wieder doas viele schiene Zeug ei de Schule mietegebroacht, woas' m
der Nekels gebroocht hoatte. Erscht wullt iech mer doas goar ne oasahn. Wie ar
mer oaber a schienes kläänes Holzscheffla zeigte, woas de sogoar enn Mast oan
zwee Segel hoatte, oan enn klenn eiserna Anker oan vanna, oa der Seite a nooch
der Noame „St. Niklas" droa stoan, do kunnt iech miech nemme genuck
zosoammareißa. Iech wäß heute nooch, wie iech menn Koop uuf de Schulbänke
leete oan elendichlich luusflärrte. De andan Kender lachta erscht ieber miech, dann redt'a se
uuf miech ei oan zoletzte hullte ääner a Lehrer, dar de nooch ei seiner
Schulwohnung soaß. Wie dar koam, härte iech uuf zo plärr'n. Oaber vo memm Schmerze
hoa iech'm nischt gesäät. Uuf ämool packte miech äne gruuße Wut uuf Ignatzan. Deswäger
zeigte iech'm a ne meine ferticha Rechenuufgoaba zom Oabschreiba. Weil ar, oan
ar hoatte nischt rechtich gerechnet, kriecht' ar vom Lehrer a poare gelangt.
Dodrieber hoa iech miech gefräät oan doocht' mer, doas hoot ar etz dervoo. Do hätt doch der Nekels etz amool zom Fanster reigucka
kenna, do hätt ar doch daan Ignatz zerknerscht met semm foalscha Rechnan
gesahn. Doderzu miech, wie iech met menn rechtija Rechenuufgoaba stolz ei meiner
Schulbanke soaß. Iech kriechte a kä schlecht' Gewessa, weil iech nää gesäät hoatte,
wie miech Ignatz uuf häämzu gebaata hoatte, nochmetz miet'm sei schienes Scheffla
ei der Miehlbaache schwemma zo loon. Oan ubadruuf macht' iech goar nooch ääne
Feindschoaft der Aala zo ääner Feindschoaft der Kender. Iech toat'm vierhala,
doaß mer ju ieberhaupt verfeindet wär'n, weil de sei Voater wäger'm Bronne met
memm Gruußvoater änn Prozeß gemacht hoatte oan mei Gruußvoater onscholdig
oall's hoot bezoahla missa. O, iech woar woll uuf m besta Wääge, a schlechter
Kalle zo war'n. Zwee Wocha genga ei's Land. Der Ignatz kriechte emmer efter
Schnicke ei der Schule. Ne blooß, weil ar ne gutt rechnan kunnde, a beim Lasa
oan Schreiba hoot ar nemme rechtich mietgekonnt, wie der Lehrer määnte. Dar
oaber merkte nischt dervoo, doaß iech derhender stackte, weil iech'm ju nemme
geholfa hoa. Oaber meine Frääde ieber de Schnicke, die de dar Ignatz kriechte, wuur
emmer klääner. Se woar lange nemme asu gruuß wie die vom 7. Dezember! 's woar der 20. Dezember, wie Ignatz nooch der Schule uuf häämzu
zu mer koam oan freete: „Kemmst'n heute miete Schefflafoahr'n?" - Nooch
heute sah' iech seine bittenda brauna Aacha ei semm ruta, robusta Gesechte ver
mer. 'n Funka Frääde kunnt iech drenne sah'n, weil ar oan doochte, doaß iech
verlächte mietmacha wellde. 'n Aachableck doocht iech mer, doas kunnde verlächte
ganz schien sein! -Oaber nää, mei Groll woar stärker, oan iech sääte: „Na gell,
doaß iech diech vo manne oab wieder oabschreiba loon sool, nää, iech war miech
hitta!" Iech drehte miech emm oan geng allääne wätter. - War hätte
zo dar Zeit denka kenna, doaß iech dodermiete ääne schwäre Schold uuf miech
geloada hoatte?" Ooms, korz ver'm Fensterwar'n, soach iech, wie de Mellern pläkert
ieber a Hof rannte. Der Meller oan de Dienstbota henderhar. Sogoar de aale,
loahme Meller-Gruußmutter hompelte bis ver'sch Tor. Glei druuf broochte der
stoarke Mellerknecht Ignatzan oageträän. Dar hoatte alläne met semm Scheffla spiela
wella oan ies derbei ei de eisekaale Miehlbaache gestärzt! Ei mer drenne woar erseht amool oall's wie gelähmt, erschrocka
woar iech. Vo ääner Schoadafrääde woar nischt zu spian, oan iech doochte, woas
de etz woll war'n wird. Fenster wuursch ei der Stube, oan emmer fensterer oan kaäs
machte de Loampe oa. 'S Hazze schluch mer bes zom Hoalse. Oalle woar'n se stelle.
Der Gruußvoater sääte nischt, de Tante a ne, oan's blieb wätter fenster ei der
Stube. Draußa geng uuf ämool a stoarker Wend luus, dar de zom Storme wuur. Iech
hoatte Angst. Met memm Ritschla rockte iech ei de Uufahelle nei. Do wuur onser
Hund biese, weil iech'm senn Ploatze wegnoahm Draußa rompelte Mellersch Kotsche met zwee Loaterna droa verbei. „Etz hoan se a Dokter gehullt!", sääte der Gruußvoater. ,,Ma wääß, ma wääß", sääte de Tante. Miech packte woas oa der Gorjel, oan iech broochte nischt raus, wie iech de Tante freen wullde, woas se gemäänt hoatte miet „ma wääß, ma wääß", oan oab de doas etwan hääßa soll, doaß de Ignatz ward sterba missa! Onser Häusla wuur mer zo enge. Iech schliech miech naus oan
rannte nieber zom Mellerhause. Ääne Weile stoan iech ver der Tiere, oan mer woar
kalt. Wie de ääne Määd rauskoam, freet iech se, woas met Ignatzan ies. Se säät
mer, doaß der Dokter nischt versprecha kunnde, weil der Ignatz met offna Aacha
doliega tat, oaber nischt häärn oan ne reda kunnde. Langsam kehrt iech em, lahnte miech oa Meller'sch
Goartamauer, geng dann uuf onser Häusla zu, satzte miech uuf ons're Tierschwelle
oan guckte emmerfatt uuf de hella Fanster vom Mellerhause. Asu foand miech
meine Tante, hullte miech rei oan broocht miech ei's Bette. Iech foand kääne Ruhe, weil oan mer geng der MellerIgnatz
ne aus'm Koppe. Ar hoatte de Aacha offe! Wenn'm die blooß ne zufoalla mechta,
da braucht ar verlächte a ne zo sterba! Eim Traame hielt iech'm de Aachadeckel met menn Fengarn offe. War iech blooß miet'm geganga, do war ar a ne ei's Woasser gestärzt. Ei meiner gruußa Angst hoa iech sugoar zom heilja Nekels
gebatt, daam äänziga Heilija, daan iech ne leida koan, weil ar miech emmer
vergassa hoatte. Heiliger Nikolaus, flehte iech, doas woar schon rechtich, doaß
der mer nischt gebrooeht host, weil iech doch asu schlecht bien. Ieber Ignatzan
oaber mech'ste diech dooeh derbarma, dar ies doch emmer gutt gewaast, oan dar
seilt' doch laba blein oan wieder gesond war'n! Drei Tage vergenga, emmer wieder hoatt' iech de Määd vom
Meller uufgelauert. „Ju", säät se emmer, „der Ignatz hoot emmer nooch de
Aacha offe, deswäger ward ar schon wieder gesond war'n!" Asu hoot se miech emmer treesta wella. Oaber de Angst, doaß
Ignatzans Aacha doch zufoalla kennda, blieb bei mer. Iech kunnde ne
verstieh'n, warom ääs de Aacha offe hoan koan oan doch nischt sitt. Deswäger
freet' iech meine kluuche Tante. Die ieberleete awing oan sääte: „Der Ignatz
hoot etz groade kääne Seele!" - Doas woar oam 23. Dezember gewaast. Etz
moßt iech emmerfatt droa denka, doaß de der Ignatz ohne Seele doo-liega moßte.
Wu kennt'n de Seele etz sein? -Doch ne eim Himmel, weil oan der Ignatz woar ju
nooch netut! Weil iech ei der Nacht zom 24. Dezember wieder nee schloofa
kunnde, fiel mer ei, doaß de Ignatzan verlächt de Seele aus der Gusche geflään
sein kennde, wie ar ei's kaale Woasser gestärzt woar. Mit emm Ruck soaß iech
eim Bette. Mer woar kaalt, oan dooeh lief mer der Schwääß iebersch Gesechte.
Ignatzans Seele ei der Baache dersoffa, oh Gott!!! 's erschte Mool ei memm Laba haart iech vom Kärchtoarme de
Metternachtsstunde schloon. Hoalb drehnich eim Koppe lahnt' iech miech zorrecke oan schlief ei. Dann hoatt' iech oaber
dooch nooch enn trestlicha Traam: Doas Scheffla vom Nekels woar ju a ei der Baache!
Verlächt hoot siech Ignatzans Seele droagehanga oan wuur doch noch gerettet! Oam 24. Dezember poaßt iech wieder uuf, doaß iech vom Meller
de Määd traffa kunnde. „Hoot Ignatz de Aacha nooch offe?", freet iech. „Nää",
säät se, „seit gestarn Omd hoot ar se zu!" „Ies a gestoarba?"Bis
etz nooch nee", määnt se oan geng wätter. Miech packte wieder ääne gruuße Angst, oan iech beldt'e mer
ei, doaß iech Ignatzans Seele sucha mißte! Iech rannte zor Miehlbaache.
Datt, bei der gruußa Esche, ies ar neigestärzt. Datt muß iech zoerschte sucha. Ieber Nacht woarsch nooch kälder gewoarn. Uuf der Baache
woar schon a dennes Eis. Wu sullt' iech'n etz de Seele sucha? Iech geng a
Stecke de Baache nonder. Emmerfatt soach iech Ignatzan mit zua Aacha ver mer
liega oalls toat mer wieh, bei daam Sucha oam Heilja Oomde. Iech geng oan geng, uuf ämool soach iech Ignatzans schienes
Scheffla, noohnde oam Uufer, eigefror'n eim Eise der Nacht. St. Niklas stoan
nooch droa, aach de weißa Segel woar'n nooch droa. Iech stoarrte druuf! Loach
do ne woas Weißes drenne, kennde doas verlächte de verloar'ne Seele sein? Uuf a Kniea rutscht' iech nonder zor Baache, met ääner Hand
oam Oaste vo emm Strauche, mej der andan hüllt' iech doas Scheffla aus'm Eise.
Iech traut' mer goar ne rechtich neizogucka. Etz hoatt' iech doas Scheffla oan rannte zorecke. Ieber de
weißa Felder fuhr a eisiger Wend, oan ieber memm Koppe fluucha a poar schwarze
Kroha. Feste drockt' iech's oa meine Brost, iech woar zofriede, oaber dooeh
vuul Angst. Wuhie dermiete? Mech zuuch's derekt zom Meller. Kaalt gefroar'n woar'n
mer de Hände. Met der rechta hoa iech's Scheffla gehaala, met der linka rieß iech
a poar Moole feste oa der Klangel ver Mellersch Haustiere. Laut oan schrelle
fuhr doas Geklengle doarch doas tuutastelle Mellerhaus. Met emm biesa Gesechte
machte der Meller de Tiere uuf. Ar schempfte ieber doas laute Kliengan. Iech
oaber stoan ernste oan feierlich do, wie zom Bata. „Iech breng' Euch Ignatzans
Scheffla, verlächt ies seine Seele drenne!", säät iech. Der Meller noahm mer
doas Scheffla oab, sääte nischt oan machte de Haustiere zu. 's woar Oomd gewoarn, Heilijer Oomd. De Lichtlan oa onser'm
klänn Chrestbäämla woar'n nooch ne oagezendt. Uuf ämool geng de Tiere uuf; der
Meller koam nei. „Seid mer ock ne biese, doaß iech oam Heilja Oomd asu plotze
zu Euch komm!", säät ar zo ons. „Der Dokter ies groade dogewaast oan hoot siech
Ignatzan oagesahn oan määnte, doaß ar oan kennde bestemmt wieder gesond war'n.
Doas woar ääne schiene frohe Botschoaft ver ons oalle, oan weil ihr hoatt emmer
nooch Ignatzan gefreet, wullt iech euch vo dar gruußa Frääde glei sään!" Oalle ei der Stube woarn freundlich zom Meller. Iech woar
ergreffa, oaber sääte nischt. Aach ne, wie ar nooch derzehlte, doaß de Ignatz
groade do de Aacha uufgemacht hoatte, wie iech asu laut oa der Haustiere
geklengelt hoa. Do derbei, määnte der Meller, hoot ar a senn Verstand wiedergekriecht!
Oan oalla ei Mellersch Hause wär'n de Aacha iebergeganga, wie se gehärt hoatta,
doaß iech miet'm Scheffla a Ignatzans Seele wiedergebroocht hoan kennde.
Hersche
Wohl in keinem
Wörterbuch findet man das Wort Hersche, das ich als Titel für meine kleine
Geschichte gewählt habe. Hierbei handelt es sich um einen Namen, den unsere
Familie für eine Kuh erfunden hat. Wie der Name, so war auch manches an dieser
Kuh außergewöhnlich.
So vergleichsweise ihre Hörner, die lang, spitz und
leicht nach oben ausladend mit etwas Fantasie an das Geweih eines Hirsches
erinnerten. Von dem Wort Hirsch stammt auch die mundartliche Abwandlung
Hersche. Wir hatten fünf Kühe in unserem Stall, vier mit einem e am Namensende:
Tocke, Nelke, Schecke und eben Hersche; und die fünfte, die jüngste, hieß
Muschel- Daß Tiere einen Namen hatten, deutet schon darauf hin, wie eng die
Beziehung zwischen Mensch und Tier war. Einen Namen hatten auch unsere Katze,
die Minka, und unser Schäferhund, der Rolf Hinzu kamen die zahlreichen
namenlosen Tiere, zu denen wir ein recht gutes Verhältnis hatten: die Schweine,
Hühner, Gänse und auch 12 Völker Bienen im Bienenstand. Und nicht zu vergessen
die etwa 20 Nester mit Rauchschwalben im und am Haus. Wir fünf Kinder und die
'Eltern lebten mit all unseren Tieren ja eng zusammen. Auch die Tiere, vor
allem unsere Kühe, hatten ein zutrauliches Verhältnis zu uns. Sie ließen sich
gern streicheln, am liebsten am Hals. Dann streckten sie ihren Kopf weit nach
vorn. Auch das Putzen mit Striegel und Bürste behagte ihnen. Wenn wir sie auf
der Weide riefen, kamen sie gleich. Auch beim Pflügen oder vor den Wagen
gespannt, reagierte vor allem die Hersche auf Anruf sicher: Hü bedeutete Gehen,
Prr Stehenbleiben, Tschihii nach links Gehen und Hott nach rechts. Wenn die
Kühe auf der Wiese weideten und wir riefen „Hoanei", dann gingen sie nach
Hause. Die Hersche stand in unserem Kuhstall am ersten Platz. Mein Vater hatte
sie als Kalb im Nachbardorf gekauft und groß gezogen. Aus dem Kalb wurde eine
Färse und daraus bald auch eine Kuh; denn die Hersche brachte ein Kalb zur
Welt. Daß es bei Tieren auch echte Mutterliebe gibt, das konnten wir nun
erfahren. Die Hersche leckte ihr Neugeborenes, bis es ganz sauber war; sie
säugte es und es durfte ganz dicht bei ihr schlafen. - Nur konnten wir nicht
jedes Kalb behalten; d.h., nach einigen Wochen haben wir das Kalb
verkauft. Und nun mussten wir einige Tage
(und Nächte) ein schmerzliches Rufen ertragen, bis es die
Hersche einsehen musste, dass ihr Kalb nicht wiederkam. Durch
intensives Streicheln haben wir damals versucht, sie zu trösten. - Und
dieses Spiel wiederholte sich jedes Jahr.
Die Hersche unterschied sich in mancherlei
Hinsicht von den anderen Kühen. Sie war einfarbig braun mit einem weißen Stirnfleck, die
anderen waren alle gescheckt Sie war größer, etwas schlanker, aber kräftiger
und robuster als die anderen und bei der Arbeit ausdauernder. Sie gab nicht
ganz so viel Milch, aber dafür war der Fettgehalt höher. Die Hersche gehörte
rassisch zu dem Grafschafter Gebirgsvieh und darum konnte sie alle von
ihr erhofften Erwartungen leicht erfüllen.
Wie es bei den
Kleinbauern in Waldgrund üblich war, wurden die Kühe auch als
Zugtiere genutzt; denn Pferde waren für Betriebe dieser Größenordnung
einfach zu teuer. Kühe gaben Milch, brachten Kälber zur Welt, zogen die
Ackergeräte und auch Wagen. Alle diese Aufgaben meisterte unsere Hersche
meisterhaft. Sie war kräftig genug, um den ganzen Tag den Pflug zu ziehen; das
mit einer zweiten Kuh zusammen. Die Hersche ging dann links als „Sattelkuh",
hatte also eine „leitende" Funktion. Rechts daneben ging die
„Handkuh", die sich unterzuordnen hatte. Und so erledigten wir mit
unseren Kühen alle Arbeiten, die auf dem Feld anfielen. Und außerdem wurden wir
- und das war gerade in den Kriegsjahren wichtig - immer mit Butter und
Milchprodukten gut versorgt
So gingen die Jahre dahin. 1939 begann der
Zweite Weltkrieg. Für uns in unserem Gebirgsdorf änderte sich zunächst nicht
viel. Alfred musste 1941 Soldat werden, und wir anderen erledigten
unsere Arbeiten in der Schule und eben auf unseren Feldern. Daß Deutschland diesen
Krieg nicht gewinnen würde, stand für die Waldgründer wohl schon 1940 fest. Vor
allem, als es nach Russland ging, wusste man, Hitler würde es wie
Napoleon ergehen; und so kam es auch. Die Ostfront rückte immer näher
an Schlesien heran. Und im Frühjahr 1945 waren die russischen Truppen bis an
den Gebirgsrand vorgestoßen. Die Angst wuchs ständig; Flüchtlinge strömten in unser
Dorf, viele zogen in Wagenkolonnen weiter - und wir blieben.
In dieser Zeit wurden auch Viehherden in Richtung Westen getrieben. Einmal
gingen mein Vater und Alois ins Dorf, wo eine große Kuhherde
rastete. Von dort brachten sie eine junge rotbunte Kuh mit, die als Lotte in
unserem Stall Platz fand. Am 8. Mai 1945 kapitulierte das Deutsche
Reich bedingungslos und am 9. Mai 1945 um 12.30 Uhr betraten russische Soldaten
zum ersten Mal unser Haus. Die große Frage war, was nun geschehen würde.
Plünderungen, Vergewaltigungen, Erschießungen gehörten zum Alltag. Die
wildesten Gerüchte kursierten, denn es gab kein Radio und keine Zeitungen. Es
hieß, die Deutschen würden nach Sibirien verfrachtet, und Schlesien würde an
Polen angegliedert Der Abtransport nach Sibirien blieb uns erspart. Aber
bald tauchten polnische Soldaten und Milizionäre auf; und in den
Rathäusern etablierte sich die polnische Verwaltung. Die Sehulen waren geschlossen und die
Betriebe stellten ihre A rbeit ein. Im Schwarzhandel konnte man noch
Lebenswichtiges erwerben - und immer noch die Ungewissheit Aber die
Abtrennung Schlesiens von Deutschland traf wohl zu.
Wir haben unsere Feldarbeit weiter erledigt.
Wir Jungen waren ständig auf der Hut, ob nicht russische Soldaten
auftauchten. Und das war oft der Fall. Dann hieß es, schnell der Mutter und der
Schwester
Bescheid sagen, damit sie sich verstecken konnten, um Vergewaltigungen zu
entgehen. - In dieser Zeit der Rechtlosigkeit zogen Banditen und russische
Soldaten durchs Land. Und eines Tages, schon gegen Abend, erlebten wir einen
Überfall. Ein russischer Lastwagen fuhr auf unseren Hof Ins Haus stürmten zwei bewaffnete Russen
und zwei Männer in Zivil, die wir als Deutsche erkannten. Die Russen
erschossen ein Schwein und luden es auf. Dann drangen sie ins Haus ein,
durchsuchten alles und trugen bald zwei große von Flüchtlingen bei uns
abgestellte Reimörbe und noch manches andere hinaus zu ihrem Auto. Die beiden Zivilisten
gingen in den Stall, banden unsere Hersehe ab und zogen mit ihr los.
Die Kuh folgte wohl willig. Wir konnten ihr nicht helfen. So
verschwanden die Räuber am Waldrand in Richtung Volpersdorf, was unser
Nachbar beobachtet hatte. - Am folgenden Tag waren Bekannte aus dem Nachbardorf
bei ihrem Unterstand, den sie im Gebirgswald in etwa 800m Höhe als Versteck für
ihre Pferde gebaut hatten, um dort zum Rechten zu sehen. Und da entdeckten sie eine kurz an einen Baum
angebundene Kuh, die sie als unsere Hersche erkannt hatten. Sie sagten
gleich meinem Vater Bescheid, und der machte sich sofort auf den Weg dorthin -
und nach einigen Stunden hörten wir vom nahen Wald her einen Schrei - und wir wussten,
es war unsere Hersche. Sie kam recht schnell, etwas hinkend, auf dem
nun ihr vertrauten Weg zu uns und schnurstracks in den Stall an ihren Platz.
Etwas später traf auch der Vater ein. Wir gingen gleich zu unserer schon
verloren geglaubten Hersche, streichelten sie und meinten, Tränen gesehen zu haben. Sie war
wieder daheim und wohl zufrieden. - Was war geschehen?
Die Diebe waren mit
der Kuh losgezogen, wollten sie wahrscheinlich im Nachbardorf
schlachten und sich damit Geld verdienen. Offensichtlich hatten sie es nicht
gewagt, um diese Zeit mit dem Beutegut ins Dorf zu kommen. Sie hätten
ertappt werden können. So hatten sie die Kuh im Walde gut versteckt an einen
Baum gebunden, um sie später von dort abholen zu wollen. Und nun war die Hersche
doch wieder in Waldgrund!! Aber! Die neuen Machthaber - die Russen und
Polen - hatten nun das Sagen. Und das Schicksal nahm seinen Lauf! Motorräder
und Radios waren abzugeben. Und dann auch Vieh! Eines Tages kam ein Pole von der
Gemeinde, eine Kuh müsste zu einem Sammelplatz gebracht werden* Die
Wahl fiel auf die Hersche! Mein Vater gab ihr noch ein großes Stück Brot und
auch Wasser zu trinken, dann zog er los - wir waren alle sehr traurig. Ich
ging mit. Am Sammelplatz in Neurode war schon recht viel Vieh
beisammen. Man nahm uns die Kuh ab - und wir sollten nach Hause gehen. Noch lange haben wir
zurückgesehen, und die Hersche lief am Zaun entlang, sie wollte doch mit uns
zurück. Lange stand sie da -und wir mussten schließlich allein nach Hause
gehen! - - In eine große Herde eingereiht, ist unsere Hersche dann in
Richtung Osten getrieben worden. Wo sie ihr Ende gefunden hat, bleibt ungewiß.
Der erste Platz im Stall war nun leer. Einige Zeit später kam ein russischer Lastwagen
in unseren Hof, fuhr rückwärts vor die Stalltür, und eine Färse wurde
aufgeladen. Auch die gescheckte Tocke haben wir auf tragische Weise
verloren. Wegen Komplikationen bei der Geburt ihres Kalbes musste sie notgeschlachtet werden.
|

|
Vater mit Hersche
und Tacke
Und bald kam ein
polnischer Verwalter in unser Haus - und wir mussten für immer
unser Waldgrund verlassen. In Erinnerung blieben uns alle Haustiere, unsere
Häuser, unser Garten, die Felder, die Wiesen und der Wald - halt unser
kleines Paradies, unsere geliebte Heimat. - So hat der Zweite
Weltkrieg viele Wunden und auch bleibende Erinnerungen hinterlassen, zu
denen auch das Schicksal unserer Hersche gehört.
Hermann Günzel
…..als wir noch an die Obrigkeit glaubten, den Behörden
vertrauten, sie achte-ten, oder gar fürchteten, - ihnen vertrauten, - und uns an sie wenden
konnten! Ausgedrückt durch die Uniformen. Die Uniform galt als allwissend, nicht
nur in der Grafschaft war das so, sondern im ganzen Lande. Ja, und weil wir
nicht so ganz weltfremd waren, wurde auch schon einmal außerhalb der
Grafschaft Glatz geheiratet, gelebt,
oder die Braut mit in die Heimat gebracht.
Heinrich hatte „Die Seine“ aus der Pfalz in die Grafschaft
Glatz verpflanzt.- Weil Mundarten viele Wurzeln haben, war ein Gemisch oft
ähnlich, - nur die Lautung klang anders!! Als Heinrichs „Seine“ einmal in Glatz
zum Einkaufen war, und sich,“ frauenüblich,“ an so vielem verguckt hatte, war ihr Zug na-türlich
weg. Wie aber sollte sie jetzt, wie vorgesehen, über den Bahnhof Möhlten zurück nach Eckersdorf gelangen??
Aufgeregt machte sie sich jetzt vom Ring aus auf den Weg zum
Stadtbahnhof, unsicher, ob und wann wohl
ein Zug noch nach Richtung Eckersdorf fährt. Da sah sie einen „ Bahner in Uniform!!“ Hurtig schritt sie auf ihn zu
und fragte, auf Pfälzisch-Glatzer Dialekt: “ Sie!! Sie! Herr Beomter! Wenn
fährt denn mein Zuck!!“ Der Beamte schaute ganz verdutzt, Fragte: „ Ja, liebe
Frau, wo möchten Sie denn hin???“ „No Mehlte!! No Mehlte !!“ Sagte sie ganz
aufgeregt. Der Beamte schmunzelte, zog sein kleines Dienstheftchen aus der
Seitentasche und beruhigte sie mit de nächsten Zugverbindung.
Selige Zeiten, - ohne Fahrkartenautomat, - ohne Computer und
ohne Internet.
Erhard Gertler
Die feierliche Vasper ei der Wollfahrtskerche
Es ies lange haar, da koam amol a aler Pauer zu da
Gnadenmutter ei Telgte. Er hotte siech fein ogezään miet em weißa Hemde , on em
schwoarzer Oazug. Oaber woas die Leutlan befremda toat woar sein weißes Tichla em
a Hoals. Dieser Moon frete miech, sään se amol, wu ies denn nu die Vasper, iech ho se
scho ei der Kerche gesucht , oaber nischte ne gefonda. Iech schüttelte dan Koop,
on sääte zu em, doas die feierliche Vasper
a Noachmittigsgottesdienst ies. Do kroatzt siech da Pauer daan Schadel un maent, na ju, do muus iech woll
hungrig hääm giehn.
I.R.
Die Frau Oberinspektor Bittner hatte sich in einem
schlesischen Gebirgsdorf nach einer Sommerfrische umgeschaut. Sie hatte auch
etwas gefunden, was ihr zusagte. Wieder daheim, war ihr eingefallen, daß ¦sie
vergessen hatte, etwas recht Wichtiges zu inspizieren. Deshalb schrieb sie an
den Wirt und bat um Auskunft,wie es denn mit WC beschaffen sei. Der brave Wirt
konnte mit der Abkürzung nichts anfangen. Man kannte in Ober-Hübnersdorf zwar
ein Klosett, auch eine Abort, sogar eine Toilette, aber WC? Die
Stammtischbrüder konnten auch nicht weiterhelfen, auch auf der Bürgermeisterei
kratzte man sich hinter den Ohren. Schließlich kristallisierte sich die Meinung
heraus, es könne wohl die Wald-Capelle im nahen „Puusch" gemeint sein. Deshalb
bekam die Frau Oberinspektor folgenden postalischen Bescheid: Sehr geehrte
gnädige Frau! Habe Ihre Anfrage erhalten, und freue ich mich, Ihnen eine
günstige Auskunft erteilen zu können. WC liegt etwa 3 km vom Gasthof entfernt
sehr malerisch im Wald. WC ist bei allen Gästen und Einheimischen sehr beliebt.
Manche bleiben gern den ganzen Tag an diesem idyllischen Ort und Familien nehmen sich dann wohl auch mal einen Picknick-Korb mit. Die Entfernung ist allerdings ein wenig störend, besonders für jene, die WC regelmäßig zu besuchen pflegen. Wer wenig Zeit hat, kann auch unser hauseigenes Automobil benutzen. WC ist ein ehrwürdiges altes Gebäude mit schönen großen Fenstern. Es hat 50 Sitzplätze. An Sonn-und Feiertagen wird geistliche Musik geboten. Es ist ratsam, sich vorher anzumelden, weil schon öfter mehrere Besucher keinen Platz mehr fanden. Deshalb soll WC in absehbarer Zeit erweitert werden und soll dann 90 Sitzplätze haben. Auch sollen die harten Holzbänke durch bequeme Polster ersetzt werden. Verehrte gnädige Frau, vielleicht treffen wir uns gelegentlich dort. Leider bin ich z.Zt. gesundheitlich nicht recht auf dem Posten, so daß ich nicht so oft hingehen kann, wie ich wohl möchte. Für heute verbleibe ich mit dem Ausdruck der Ergebenheit IgnasSchimmelpfennig
Wirt zum Roten Ochsen
Er wundert sich bis heute,warum die Frau Oberinspektor
nichts mehr von sich hat hören lassen.
Hans Zwiener
Die Hexe vom Rihstän
(aus
Volpersdorfer Heimatblätter Nr. 14/2007, Seite 34 bis 35)
Will man
von Köpprich im Eulengebirge das Bielauer Plänel
erreichen, muss man den Bieler Grund
entlanggehen. Zu beiden Seiten des schmalen Gebirgspfades befindet sich Hochwald, und in der Senke fließt
glucksend ein Wässerlein. Auf halber Höhe
zum Plänel
ragt zwischen mächtigen Tannen und Buchen ein Felsen hervor,
auf dessen Rücken
man weit ins Tal schauen kann. Das ist der Rihstän, vom Volksmund so genannt. Waldarbeiter und
Fuhrleute erzählten folgendes von dem Ort: Als der 30-jährige
Krieg im Lande tobte, soll auch im Eulengebirge eine sehr schwere Zeit gewesen sein, denn Söldnerhaufen
zogen plündernd durch die Siedlungen. Als wieder einmal ein Söldnerhaufen das Gebirge übersteigen wollte, um ins Land zu kommen, wollte eine alte, kranke und verwahrloste
Frau zurückbleiben und suchte ein Unterkommen. Sie erzählte
Leuten, dass sie ehemals Marketenderin gewesen wäre und Geld genug hätte,
um alles bezahlen zu können. Da man aber in ähnlichen
Fällen schon trübe Erfahrungen gemacht
hatte, nahm man die Frau nirgends auf. So taumelte die Alte dem Söldnerhaufen
nach und gelangte in den Bieler Grund. Am Rihstän aber konnte sie nicht
mehr weiter. Da bemerkte sie die Höhle mm Felsen und suchte
darin Unterschlupf. Sie
richtete mit letzten Kräften ein Lager aus Moos und Laub, legte sich
darauf nieder und
dachte verbittert an ihr baldiges Ende.
Nach zwei Tagen Ruhe hatte sie
sich merklich erholt. Sie lief ans Wässerlein und erfrischte
sich und sah sich dann nach Beeren und essbaren Wurzeln um. Die nächsten
Tage
sammelte sie Tee und Heilkräuter und bot sie den
Siedlern an. Nebenbei kaufte sie getragene Kleidung und gebrauchte Gegenstände.
Sie wollte hier bleiben und sich die Höhle wohnlich einrichten.
Nach und nach wurde sie bei den Siedlern bekannt und gelitten. Doch etwas sollte
ihr zum Verhängnis werden. Sie konnte nämlich
aus der Hand
wahrsagen, wusste allerhand Zauberkunststückchen und braute für
die jungen Leute
Liebestränke. Nun meinten die Siedler, sie sei eine
Hexe.
Als nun gar unter dem Vieh der
Siedler eine Seuche ausbrach, sah man es als eine böse Tat der Hexe an. Sobald sie sich sehen
ließ, bewarf man sie mit Steinen. Eines Tages fand man die Alte
erschlagen vor ihrer Höhle liegen. Der Hexenwahn der damaligen Zeit hatte wieder
sein Opfer gefunden. Man schleppte die Leiche in die Höhle
und schüttete den Eingang mit Erde gut zu.
Seit dieser
Zeit geht die Sage umher, dass die Hexe zu bestimmten Tagen auf dem Felsen stehe und mit der Faust ins Tal drohe und den
Menschen, die gerade dort vorbei müssen,
Unheil bringe.
A stolzer Hoahn
Amol wuchs a klänes Schiepala zo am stoattlicha Hoahne mit
am prächtiga Gefieder azu. On dar stolzierte sehr selbstbewußt ei säm
Hinnerhofe rem, duldete kann Rivala on woar dervone ieberzeugt, niemols änn
Fehler zo begiehn. Allmählich wurde ar oaber taab ferr oalle weisa Rotschläge on
aach blend ferr oalle Gefährdunga. On asu woar ar schließlich äne leichte Beute
ferr änn Fochs. Ei ämm nohnda Peschla foand ma dann bloß noch a poar bunte Fadarn,
die oa doas ieber aus stolze Wesen erennerta.- On doas woarschll On beim Fochse
wie aach bei sann Genossa woar der Opptiet off Hinnerflääsch asu gruuß geworn,
doaß se siech äne Henne noch der andarn hullta. Do werd ma halt a beßla
nochdenklich ieber doas, woas Stolz letztlich eibrängt. - Wie ofte begäänt ma
doch Männarn, Frauen oder ganza Völkarn, ferr die es besser gewaast war, sie
hätta vo dam stolza Hoahne woas gelannt.
Hermann Günzel
Rond em’s Fansterbottla
O je, die Wenter woarn woll Derhääme stränge! Oaber mier
Groafschoafter woßta ons zo halfa. A koam ju oalle Joahre, da biese Wenter,
also mußte ma doodruuf vierbered’t sein. Nee oalle hoatt mer Doppelfanster,
derwäjen wurde schon em Sommer Moos aus’m Posche gehullt on getroijt. Asu em
Oallerhei-lijen rem hookte ma fer die äfacha Fanster draußa die schinn
verzierta Fanster-braatlan ei. Ei a Zweschenraum koam troijes, wääches Moos oder grien gefärbte
Holzwolle. Dermit doas oalles a hibsch aussoach stackte ma ei doas Moos, oder
die Holzwolle bonte Struhbliemlan. Die klänn Fanster woarn zwoar em etwa fuffza
Zentimeter klänner geowarn, aber ma woar geschetzt on der Wenter kunde koamma.
Ar kaom, wie emmer, met gruußer Kälde on ließ die Fanster ei der Nacht bis nuff
met schiena Eisbluma gefriarn, on Morjas kunda mier Kender, met viel Spaaß, die
erschta Lächlan ei die „Blumabeete“ haucha. Doas Eisswoasser lief oam Fanster
nonder, nee ärn off a blanka Fansterkoop, doo-derfiere woar viergesorjt, nä, ei
ääne Renne oam Fansterkoppe drenne lang on off der Seite vum Fanster ei a
Bottla, woas onderm Fansterkoppe uufgehängt woar. Doas woar doas Fansterbottla,
on doas mußte iebra Tag efter geläärt waarn. Also hieß doas woll a uufpaossa!
Denn wenn doas woarm ei der Stube wurde, die Fanster oabtaata, lullerte a ganz
beßla Woasser ei die Bottlan nei. Mier Kender woarn doo emsiech bei der Sache,
kund mer sche doch ausläärn on ei der Woaschschessel met daam Woasser a weng
remproantscha. Scheffla foahrn! Oaber doas Fansterbottla hoatte aach a
Geheimnes! On wie doas met Geheimnessa ies, die bränga ääne gruuße Spoannong
miete. Nu ja, doas kaom asu! - Kamm doas die Fansterbraatlan draußa eigehanga
woarn, die schinn Struhbluma lechta toata, durfte iech doch jeda Oomd a Steckla
Zocker draußa off doas Moos oam Fansterkoppe leen. Der Kloapperstorch teet
siech doas hulla on mier geschwende a Geschwesterla bränga, sääte die Mutter.
Nu woar iech met daan Ohrn ganz bei der Sache on horchte emmer ob iech woas
hoarte wenn der Storch siech doas Steckla Zocker hullt. On doas ääne Moal, es
woar schonn fenster on ooßiech kaalt draußa, hoart mer doch woas eis
Fanterbottla lullan! „ Siste, sääte die Mutter, doas Geschwertala pullert schon
ei’s Fansternappla!“ Na, wie doas meegliech
woar, mechte iech hoite nooch wessa. –
Erhard Gertler
Die
gruuße Angst
Die
Ludwig Schneidan kläät on klenselt on jammert schrecklich stundalang, o Gott,
nä nä´s ies zom Verzweifan, mei Moan ies schon verza Toage kroank! Etz tut ach
onse änzige Ziege ganz drehnich seit
heute Nacht, ich hoa dam lieba guda Vieche en warma Eiguß schunn gemoacht! Mir
ies woarhaftig Angst on Bange, doa selta kemmt bloß ä Moläär, ääs vo dan beda watt wull
druufgiehn, wenn´s bloß nee die Ziege wär!
Von Waltraud Töpper
Der Teich vum Kneppelmeller
Nä nä, es woar nee der Teich
vum Kneppelmeller, es woar der aale Hoofeteich, a Koarpateich, schonn vu a poar
Joahrhunderta aogeleet, fer die Herrschoaft off’m Dominium. Daam Freiherrn von
Degenheym gehoarta frieher die Koarpa, oaber der Meller kunde , asu wie ars
brauchte, sei Woasser oabnahma fer seine Sääjemiehle. Die aale Baache musste
daan Teich emmer wieder uuffella. Die Braatmiehle wurde vu ons Kneppelmiehle
genannt, weil aus Stämma, Kneppan on
oallem Braate gemacht wurda. Asu viel zor Geschichte.
Mier Jenglan woßta, wenn eim
Herbste die Koarpaernte woar, on die Moanne, met Gummioaziecha on gruußa Netza
dann Teich laar machta; „ Baale kemmt der Wenter!“ Oalle Koarpa woarn zwaor nee
gefanga, andre zor Vermährong wieder ei a Teich geschmessa ei daan ma wieder
fresches Woasser ließ. Der Wenter koam, der Teich fruer zu , on mier kunda
Schlittschuhfoahrn. Die Struh-peschel, die aus daam Eise rausguckta, zeichta
ons, „doas Eis ies decke genunk, die Fesche hoan Loft on mier kenna off a
Teich!“ Kääner toat ons vertreiba, mier kunda onsan Spaß hoan! Eishockeye
spiela, Kreisel drehn, die Määdlan emkrääsa on onse Kunststecklan zeija.
Oaber, oaber, der Kneppelmeller
musste seine Braate schneida, brauchte Woas-ser! Daos Waosser soank, doas Eisa
oa a Rändarn krachte , kriechte Resse on mier Angst. – Also nischt wie ronder
vum Eise!! Andarn Taag woarsch, oals wenn siech die Decke wieder gehooba hätte,
mier woarn wieder droffe. – Bes es
wieder knackte on knärrschte. Der Kneppelmeller toat wieder Braate schneida.
Mier fuharn wetter, bes es taate. Ieberm Eise stoand daos Woasser, es wur
gefährliech. –
Wenn ieberlääft, werd’s
gefährliech, doas woßt mer, weß mersch a hoite nooch?
Erhard Gertler, Gabersdorf
Der Geist im alten Speicher der
Volpersdorfer Brauerei.
Eine alte
Erzählung
Es gab in
früheren Zeiten, schon immer eine Brauerei in Volpersdorf und auch heute, stehen noch einige ihrer Gebäude. Sie lag
ein wenig abseits des Dorfes, dort wo ein klarer Bach gutes Brauwasser
bescherte. Es gab sehr gutes Bier, von dem
auch heute noch so mancher zu erzählen weiß. Just in diesem Gebäude, trug sich
eine unheimliche Geschichte zu. Kinder, die dort wohnten, streiften neugierig
in den alten Gebäuden umher und kamen auch in einen alten Speicher, dessen Türe
schon nicht mehr vorhanden war. In diesem Türrahmen, erschien zeitweise ein
Geist, der so beschrieben wurde. Er hatte einen Kopf, der wie ein rundes Wespennest aussah. Zudem
trug er einen Rock auf den Schultern, der bis zu den Knien reichte. Beine hatte
er keine. Gingen die Kinder auf den Türrahmen zu, war der Geist nicht mehr zu
sehen, entfernten sie sich, kam der Spuk zurück. Deshalb glaubten sie an einen
Scherz der großen Jungen, und suchten nach Fäden, Drähten, oder einem
Mechanismus, der den Geist beliebig hin
und her transportierte, aber man fand nichts dergleichen. In einem Gang des
Speichers lag ein Schweinetrog aus Holz mit dem Boden nach oben. Man wollte
nachsehen, ob der Geist vielleicht darunter steckt. Ohne ihn zu berühren, drehte
sich der Trog mit einem heftigen Rumms auf die andere Seite. Leider war sonst
nichts zu sehen. Seit diesem Schrecken, wurde der Speicher gemieden.
Eine andere Geschichte erzählt
von einem Gang, der in einem heute abgerissenen Gebäude der alten Brauerei sein Ende nahm, kommend vom
Dominium. Es war wohl ein alter Fluchtweg, der in den Wirren der Kriege und
Raubüberfällen, denen Adelige und ihre Besitztümer ausgesetzt waren, angelegt
wurde.
I. Reimann
Die Sage von der
Hoverone
In Volpersdorf und Umgebung erzählte man sich folgende
Geschichte.
Eine Magd Namens
Veronika diente im Schloss in Ober-Volpersdorf. Sie war jung und sehr
schön, und wollte den Baron als Liebhaber gewinnen. Sie war intrigant und meinte, sie
gehöre eher ins Schloss als gemeine Magd zu sein. Es entstanden eheliche
Zwiste in der Familie des Barons, die dazu führten, dass die Frau mit den
Kindern nach dem im Niederdorf gelegenen Dittrich-Hof zog. Nun hatte Veronika
erreicht, was sie wollte. Erst mal soweit gekommen, benützte sie ihre Macht, um
allerhand Schandtaten zu verüben. In jeder Weise schikanierte und betrog sie
das Gesinde und die Bauern. Sie gab dem Gesinde nicht das ihm zustehende
Deputat, nicht den verdienten Lohn, ließ die Bauern mehr Hand- und Spanndienste
leisten, als sie verpflichtet waren, schlug bei den geringsten Anlässen
unbarmherzig auf die Leute ein und wirtschaftete vor allen Dingen viel in ihre
eigenen Taschen. Lange jedoch währte dieses tolle Treiben nicht, ein früher Tod
machte ihr den Garaus. Ihre Seele konnte zur Strafe für die verübten
Schandtaten keine Ruhe finden, sie ging um. In den Ställen machte sie das Vieh
wild, so dass es sich von den Ketten los riss, wild
durcheinanderlief und hinschlug. In die Feueressen kroch sie und blies
den Leuten das Feuer aus. Im Dachgeschoß des Schlosses wohnten vor vielen
Jahren zwei Diener, die manchmal recht späht heimkehrten. Einst, als sie wieder
einmal zur Geisterstunde ihr Zimmer aufsuchten, bemerkten sie einen Lichtschein
durch einen Türritz. Neugierig, wer zu dieser Zeit in Ihrer Stube etwas zu
suchen habe und zugleich beklommen, öffnete er ein kleinwenig die Tür und
gewahrte darin die Verone ihr schönes langes blondes Haar vor dem Spiegel
kämmend. Der andere, der jeder Zeit zu lustigen dummen Streichen aufgelegt war,
rief der Geistergestalt, um sie zu necken, zu: “V’rone, du konnst
m’r aach amool de Looda kämma. “ Kaum war das Wort heraus, da drehte
sich die Verone um und will die beiden fassen, die entsetzt die Treppe hinunter
rennen. Eine wilde Jagd ist es die durch das Schloss ging In Ihrer Angst
rennen die beiden in den Pferdestall, und verstecken sich unter den
Futterkrippen. Da rief die Verone; "Wärt Ihr nicht zwischen
Stahl und Eisen, so wollte ich es Euch beweisen! Die Knechte wussten ,dass man
vor Geistern sicher ist, wenn man sich zwischen Stahl und Eisen befindet.
- Niemand hat gesehen, wohin der Geist gegangen ist. Punkt eins war er von
der Stalltür verschwunden. Ein Schaffer, der auf dem Hofe diente, nahm sich ein
Herz und beschloss, diesem Unwesen ein Ende zu bereiten. Als er einmal merkte,
dass der Geist in der Esse sei, stieg er schnell auf das Dach und zog einen
Ledersack über die Schornsteinöffnung. Nach dem der Geist das Feuer
ausgelöscht hatte, wollte er wieder auf demselben Wege, auf dem er gekommen
war, heraus und geriet in den Sack, den der Schaffer schnell zuband und
hinunterwarf. Auf einen Wagen geladen, machte er sich so schwer, dass sechs
starke Ochsen davor gespannt werden mussten, die den unruhigen Geist nach dem
Romhübel fuhren, wo er tief vergraben wurde. Um die Grabstätte setzte man noch
einen Eisenzaun. Als dieser Zaun einmal eine Lücke aufwies, trieb die. Verone
wieder im Schloss ihr Unwesen. Erst als man immer mittags die Glocke auf dem
Dach des Schlosses läutete, kehrte Ruhe ein. -Vergaß man später einmal das Läuten, ging es mit dem Spuk wieder los,
immer zwischen zwölf und eins. Es gibt noch so manche Geschichte; und immer,
wenn es in Volpersdorf unerklärliche Vorkommnisse gab, meinte man: „Do woar
wieder die Hoverone eim Spiel! “-Selbst nach 1945, als polnische Menschen das
Schloss bevölkerten, soll es nachts Unruhe und Erscheinungen gegeben
haben. Und als man diesen von der Hoverone erzählte, glaubten sie fest an die
Existens dieses Geistes. Eine Familie, die im Schloss wohnte, hat aus diesem
Grunde Volpersdorf verlassen. - So
bleiben viele Fragen offen.
Vor langer Zeit, erzählte man auch diese Geschichte von der
Hoferone.
Dort, wo heute der Campingplatz hinter dem Dominium liegt, soll
es umgehen, das heißt mit anderen Worten, es spukt. Man erzählt, dass sich in
dem kleinen Waldstreifen, der sich am
Campingplatz entlang zieht eine tiefe Mulde befindet, in der die Hoferone ihre
nicht gewollten Kinder begraben haben soll. Diese würden sich um Mitternacht durch
Weinen bemerkbar machen, weil sie nicht christlich beerdigt wurden.
Vor langer Zeit soll es auch ein Sühnebildnis in der Buchenallee
an einer Buche gegeben haben. Auch hier soll man des Nachts die Kinder weinen gehört
haben. Wer dieses Bild angebracht hat weiß man nicht, auch nicht mehr was auf diesem Bild zu sehen war. Man meint,
es wäre eine Muttergottes gewesen, was man ja auch gut nachvollziehen könnte.
Die Jagd auf dem
Rohmhübel
von Hermann Günzel
Im Eulengebirge
hat sich in den letzten Jahren das Muffelwild stark vermehrt . Allein auf der Grafschafter Seite wurde ein
Bestand von reichlich 500 Tieren festgestellt, die im Winter auch bejagd
werden. Mein Bruder Alois hegte schon seit längerer Zeit den Wunsch, die
Trophäe eines Muffelwildes aus unserer Heimat, an seiner Wand zu sehen. So
reisten wir,er und ich als Jagdbegleiter im Dezember 1993 auf Mufflonjagd ins
Eulengebirge. Von der Falkenberger Försterei aus, wo wir untergebracht waren,
ging die Fahrt mit dem Jagdführer ins Revier. Es war herrliches Winterwetter,
die Berge tiefverschneit, die Sonne strahlte vom blauen Himmel auf den
märchenhaft glitzernden Wald .Als wir von der Volpersdorfer Försterei aus dem
Weg unterhalb des Rohmhübels ( ein 741 Meter hoher Berg in der Volpersdorfer
Gemarkung ) entlang fuhren, sahen wir in etwa 200 Meter entfernung oben am Berg
dunkle Flecken zwischen den Bäumen. Ein Rudel Mufflons musste es sein.Der Jagdführer
und mein Bruder pirschten sich, durch große Bäume gedeckt, bis auf etwa 120
Meter an das Rudel heran und machten dabei einen starken Widder aus. Als dieser
sich hinter einem Baum hervorschob, so das der Vorderkörper und Haupt frei
waren, legte mein Bruder die Büchse an und drückte ab.Als der Schuß verhallt
war, meinte mein Bruder, er sei gut abgekommen, habe also getroffen.Und nun
stapften wir im tiefen Schnee bis zur Anschußstelle. Da lag auch das gestreckte
Tier. Aber –und nun war die Enttäuschung groß- es hatte keine Hörner; war
demnach ein weibliches Tier, ein Schaf. Der Jagdführer und mein Bruder waren
sich absolut sicher, dass sie mit ihren Ferngläsern einen Widder ausgemacht
hatten. Und nun lag ein Schaf da! Dies konnte doch nicht war sein!! Aber, etwa
2 Meter höher bemerkten wir Schweiß
(Blutstropfen) der nicht vom Schaf stammen konnte. Wir gingen der Spur nach und
fanden etwa 10 Meter höher hinter einem Baum den toten Widder. Was war also
geschehen?- Beim Schuß hatte unmittelbar hinter dem Widder das Schaf gestanden,
unsichtbar für den Jäger. Das Geschoß hatte den Körper durchschlagen und war in
das Schaf eingedrungen, das dann im Anschuß tot umfiel. Der Widder hatte noch
einige Sprünge nach oben gemacht, bevor auch er tot in den Schnee sank.Das war
ein einmaliges, seltsames Geschehen. Weil sich dies auf dem Rohmhübel zutrug,
hätte man auf den Gedanken kommen können, die Hofe-Verone müsste hier ihre Hand
im Spiel gehabt haben. Aber es handelte sich wohl um einen , wenn auch seltenen
Zufall, wobei mit einem Schuß zwei Tiere
fielen.
Ein Streich der Hofe-Verone? OderDie Mufflonjagd.
Ein Jäger wollt ein Mufflon jagen,
gesagt, getan ganz ohne zagen.
Im weißverschneiten Fichtenwald,
die Luft war eisig, bitterkalt.
Da!! Ein Widder, stark und schön,
der blieb vor seinem Weibchen stehn.
Da legt der grüne Jägersmann,
der gut versteckt im dunklen Tann,
die Büchse, auf das Mufflon an.
Es knallt sehr laut,der Jäger schaut,
zu seinem toten Widder hin,
doch nein, es war ne Widderin.
Oh Weidmannsheil, mich narrt ein Spuk.!!
Was ist das für ein böser Trug??
Ein wenig weiter, oberhalb,
da liegt der Widder tot und kalt.
Es flog die Kugel durch sein Herz,
und traf sein Weibchen hinterwärts.
Der Berg, auf dem dies so geschah,
der Rohmhübel, mit Grab der Veronika.
Bei ihren Streichen, fies und gemein,
könnte sie wohl verantwortlich sein.
I. R.
Eine Legende von der Quingenburg.
In der Nähe des Dorfes Volpersdorf, auf dem Quingeberg, soll
einst eine Burg gestanden haben, in welcher wilde Raubritter hausten. Diese hatten viele Schätze zusammengeschleppt und in den
Kellern der Burg vergraben. Eine reine Jungfrau, die in der Christnacht danach sucht und eine angezündete, geweihte Kerze in der
Hand trägt, kann die Eingangspforte zu dem verfallenen Burgkeller öffnen und nach Herzenslust Gold
und Edelsteine zusammenraffen.
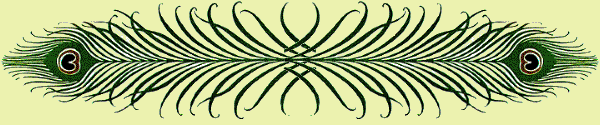
Ein Ölbaum in Volpersdorf
In der Nähe der Volpersdorfer Schule, in dem Garten des Stellenbesitzers Paul Wunsch, steht ein merkwürdiger Baum der im Volksmunde als Ölbaum bezeichnet wird. Über den Ursprung des Baumes, der heute eine Höhe von zehn Metern bei einem Umfang von 75 cm (in Brusthöhe gemessen) hat, erhalten wir folgende Zuschrift: Gegen das Jahr 1860 kam ein Franziskanermönch Phillip Gersch nach Volpersdorf und übernachtete in der sogenannten Schölzerschmiede. Er brachte seinem Gastgeber eine unscheinbare Wurzel mit, die er aus dem Ölgarten, indem unser Erlöser sein bitteres Leiden begonnen hat, entnommen hatte. Der Meister Welzel grub die Wurzel in den kleinen Garten vor seinem Hause ein und erwartete wohl nicht, daß die Selbe ein Auferstehen feiern würde. Doch, o Wunder, im nächsten Jahre kam ein Zweig mit wohlriechenden Blättern hervor, der sich von Jahr zu Jahr vergrößerte und sich zu einem hohen schlanken Baum entwickelte, der bald das Dach des Wohnhauses überragte. Der spätere Besitzer ließ den Baum, dessen Wert er weniger schätzte, umhauen. Damit war der Ölbaum aber nicht zufrieden. Er hatte in den Jahren seines Wachstums Zeit gehabt, seine Wurzeln unter der Erde zu verbreiten und ein neuer Baum, kaum zwanzig bis dreißig Schritt von dem Ersten entfernt, entstand. Derselbe steht heute noch und sendet sein kräftiges Aroma im Frühjahr, besonders wenn Regen ihn erquickt hat, allen, die hier vorüberkommen oder hier wohnen.
Auszug aus den Neuroder Heimatblättern von 1924
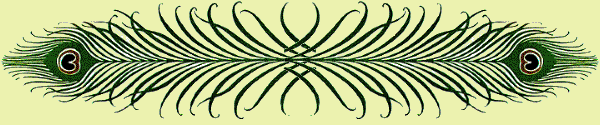

Die
Geschichte der Volpersdorfer Schölzereikapelle
Es ist schon lange her, da gab es in Volpersdorf noch eine
Schölzerei (Schulzenhof.) Der Dorfschulze war so eine Art von Bürgermeister mit
Gerichtsbarkeit. Dort stand eine junge fromme und tüchtige Magd in Diensten. Ihr
Elternhaus war in Ebersdorf nicht sehr weit von Volpersdorf entfernt, so dass Sie jeden Abend, nach getaner Arbeit nach Hause ging. In der
Schölzerei, gab es viele Mägde und Knechte und darunter auch einen rechten
Spaßvogel und Tunichtgut. Eines Abends, es war schon dunkel, als die junge Magd wieder einmal dem Elternhaus zu
strebte, da hatte er sich einen ganz besonderen Streich ausgedacht. Er zog sich
einen weißen Mehlsack über und lauerte dem Mädchen hinter einem Busche auf. Als
sie vorüberging stürzte er mit fürchterlichem Gebrüll vor sie hin. Die Magd
voller Entsetzen, griff nach ihrem Holzprügel, den sie für alle Eventualitäten
bei sich trug, denn man wusste ja nie, was so alles auf dem Wege passieren mochte. Sie befahl sich Gott
und wollte dem vermeintlichen Geist zeigen wie es ist, wenn man einem jungen
unschuldigen Mädchen zu nahe tritt. Mit der ganzen Kraft ihrer Jugend, schlug
sie immer wieder auf den Geist ein, bis er sich nicht mehr rührte. Dann rannte
sie so schnell sie konnte ihrem Elternhause zu. Am anderen Morgen in der
Schölzerei angekommen, gab es große Aufregung. Einer der Knechte, hatte auf dem
Wege zur Arbeit einen Mehlsack gefunden völlig mit Blut besudelt. Als er zitternd
und bebend hineinsah, erkannte er kaum seinen Arbeitsgefährten, der wie er
Knecht auf dem Hofe war. Jetzt erzählte die Magd ihrem Herrn, was sich auf
ihrem Nachhausewege zugetragen hatte. Der unglückliche Knecht, hatte durch einen
dummen Streich ein so grausames Ende gefunden. Später baute man zur Erinnerung
und zur Sühne die Schölzelkapelle einen großen Bildstock der noch lange in
Volpersdorf zu sehen war.
I. Reimann
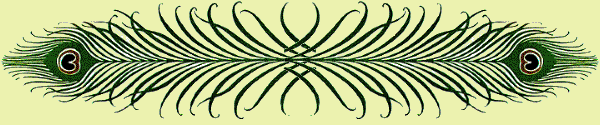
Wenn die kläne Friedel eim Goarta spielt, taucht aach glei ihr klänes Katzla uuf, doas asu lange em ihre Bäne schmeichelt, bes sie es off die Arme nemmt an strächelt. On dann schnorrt da oallerliebste Daudel on dreckt sänn Koop ganz feste a die Friedel droa. A Igel dar verstackt onder ämm Sträuchla setzt, siehtt dam Spiele zu, on es gefällt ihm. Off ämol kemmt do bei ihm a heftiges Verlanga noch selcher Zärtlichkät uuf. Ar troapst ieber a Roasa hie zor Friedel on versucht genau wie doas Katzla, siech bei iharn Bänn bemerkboar zo macha. Wie doas oaber piekst on stecht, sprengt die Friedel erschrocka zore dan klänn Kalle ganz ganne, oaber berieharn oder off a Orm nahma, nä, doas tutt se nee. Asu trottet onser Igel enttäuscht wieder zo a Sträucharn zorecke on lett siech lange nemme sahn.-War stachlich ies, koann äben off bestemmte Zärtlichkäta nee hoffa!
Hermann Günzel
nach oben zurück